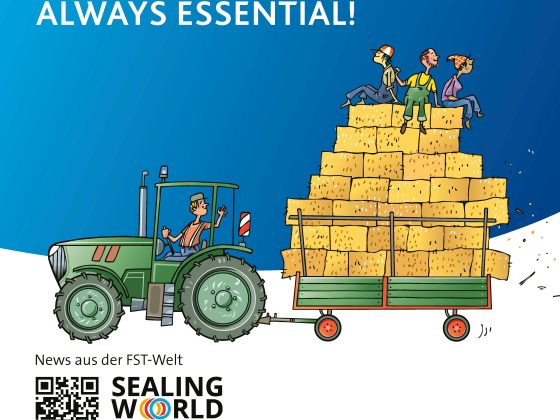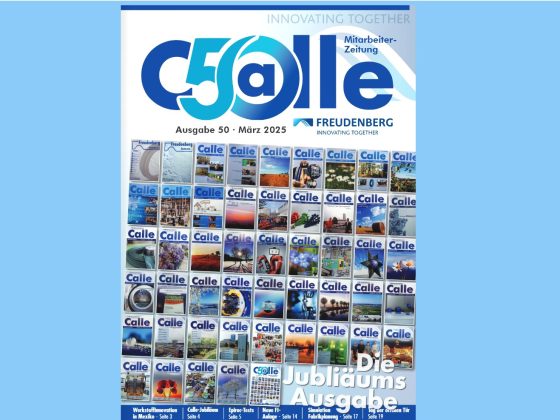Der zweite Teil der neuen Werkstoffserie befasst sich mit Gummi. In den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts bestanden Simmerringe aus einem Blechgehäuse und einer Ledermanschette. Doch dann wurde Leder knapp und teuer und Freudenberg ersetzte es durch Gummi.

Kompakt
Historie des Simmerrings: In den 1930er Jahren wurde Leder in Simmerringen durch Gummi ersetzt, da Leder teuer war. Gummi erwies sich als formstabil und elastisch rückverformbar, mit hoher Temperatur- und Quellbeständigkeit 1.
Herstellung von Gummi: Der Weg vom Natur- oder Synthesekautschuk zum Hightech-Gummi (Elastomer) ist komplex und erfordert eine Mischung aus zehn bis zwanzig Zutaten, darunter Füllstoffe wie Ruß und Kieselsäure, Weichmacher und Alterungsschutzmittel.
Vulkanisationsverfahren: Freudenberg Sealing Technologies (FST) nutzt verschiedene Vulkanisationsverfahren, darunter Compression Molding (CM) und Injection Molding (IM). Diese Verfahren unterscheiden sich in ihrem Automatisierungsgrad und der Art der Verarbeitung.
Chemische und physikalische Eigenschaften: Gummiwerkstoffe müssen je nach Anwendung beständig gegen verschiedene Medien und Temperaturen sein. Die Lebensdauer einer Gummidichtung reduziert sich bei steigenden Temperaturen erheblich.
Prüfverfahren und Innovation: FST führt Stresstests durch, um die Einsatzgrenzen neuer Werkstoffe zu bestimmen. Diese Tests simulieren reale Bedingungen und liefern wichtige Erkenntnisse für die Praxistauglichkeit neuer Materiallösungen.

Vor knapp 100 Jahren bestand der erste Simmerring® aus einem Blechgehäuse samt Ledermanschette. Doch Leder war teuer. Freudenberg suchte Ersatz und wurde fündig, ersetzte in der Dichtungstechnik sein Traditionsprodukt durch Gummi. Das überzeugte, wie sich schnell herausstellte, mit seinen guten Eigenschaften. Das formstabile, aber elastisch rückverformbare Gummi zeichnete sich unter anderem durch eine viel höhere Temperatur- sowie Quellbeständigkeit gegenüber den in den 1930er Jahren gängigen Motorschmierölen aus. Damit begann der bis heute andauernde Siegeszug des Dichtungswerkstoffs Gummi – erst im Simmerring, dann in O-Ringen, dann in Flachdichtungen…
Ingenieur oder Kuchenbäcker?
Der Weg vom Natur- oder Synthesekautschuk zum Hightech-Gummi, Fachbegriff Elastomer, ist weit. Allein mit Kautschuk – sei er natürlichen Ursprungs oder synthetisch hergestellt – ist es dabei bei Weiten nicht getan. Eine Gummimischung besteht in der Regel aus zehn bis 20 Zutaten. Wie beim Backen eines Kuchens sind die richtigen Zutaten in der richtigen Menge erforderlich.
Bei dem süßen Backwerk erzeugt am Ende die ausgeklügelte Kombination aus Mehl, Zucker, Eiern, Butter, Milch oder Kakao das gewünschte Ergebnis … und (Geschmacks-) Erlebnis. Für die perfekte Gummimischung sind neben Kautschuk vor allem Füllstoffe wie Ruß und Kieselsäure als Verstärker für mehr Festigkeit und Beständigkeit wichtig. Außerdem verbessern Weichmacher zunächst beim Verarbeiten das Fließ-, später das Dehnungs- und Quellverhalten. Alterungsschutzmittel verlangsamen die Materialermüdung, andere Zutaten schützen beispielsweise vor Ozon.
Mischwerk: Vom Verwiegen bis zum Versenden
Je nach Rezeptur werden in Rohmischwerken von Freudenberg Sealing Technologies (FST) rund um den Globus zunächst alle Zutaten aufs Milligramm genau abgewogen. In einer großen Knetmaschine werden sie anschließend zu einer homogenen Masse vermengt. Diese wird dann in einem Walzwerk durch ständiges Falten und Walzen immer weiter homogenisiert.
Am Ende werden Dichte, Härte, Festigkeit und Elastizität jeder Charge in serienbegleitenden Prüfungen genau kontrolliert. Den bestandenen Qualitätstest vorausgesetzt, wird die Mischung nach dem Abkühlen in einer sogenannten Batch-off-Anlage zu Streifen, Schnüren oder andersförmigen Rohlingen konfektioniert. Nach dem Verpacken wird die konfektionierte Mischung an die formgebenden Produktionsstätten versendet. Der Trend in den FST-Mischwerken geht dabei in allen Arbeitsschritten in Richtung vernetzter Maschinen, Digitalisierung und Automatisierung. Das Rohmischwerk in Weinheim zählt dabei zu den Vorreitern.

Aus plastisch wird elastisch
Ganz wichtige Mischungszutat sind Vernetzer, zum Beispiel Schwefel. Denn was beim Kuchen das Backen im Ofen, das ist beim Gummi das Vulkanisieren bei der Formgebung in der Serienproduktion. Bei der Vulkanisation werden die Kautschuk-Moleküle bei einer Temperatur von 120 bis 160 Grad Celsius miteinander vernetzt. Diese Vernetzung verleiht dem Gummi seine Elastizität, verwandelt plastisch in elastisch.
Ein letztes Mal zurück zur Backanalogie: Wie ein guter Konditor schreibt FST also das Rezept, mischt die Zutaten und backt sie selbst. Nur die „Backzutaten“ kauft FST zu – genau wie der Konditor, der sein Mehl ja auch nicht selbst mahlt.
Mehrere Verfahren ein Ziel: Gummi
FST nutzt in der Dichtungsfertigung aus Gummimaterialien verschiedene Vulkanisationsverfahren. Die beiden wichtigsten werden mit CM und IM abgekürzt.
Beim Compression Molding (CM) wird der Rohling in die Bauteilform des offenen Werkzeugs manuell eingelegt. Die Presse wird geschlossen. Die oben und unten durch Heizplatten erzeugte Wärme setzt die Vulkanisation in Gang. Das ist das einfachste Verfahren.
Beim Injection Molding (IM) wird die zuvor zu Schnüren oder Bändern vorverarbeitete Mischung unter hohem Druck direkt in das geschlossene Werkzeug eingespritzt und dort vulkanisiert. Das ist das aufwendigste Verfahren mit dem höchsten Automatisierungsgrad.
Weitere Verfahren heißen Transfer Molding (TM) und Injection Transfer Molding (ITM).
Je nach eingesetztem Gummi-Werkstoff müssen Dichtungen nach der Formgebung nachgeheizt werden. Im Nachheizofen gasen Zusatzstoffe sowie Bearbeitungshilfen aus und das Vulkanisations-Netzwerk wird fest verschlossen. Kurz: Durch das Nachheizen erhalten Dichtungen beziehungsweise ihre Werkstoffe ihre finalen Eigenschaften.
Chemie und Physik
Chemisch müssen Werkstoffe von Elastomerdichtungen je nach Anwendung beständig gegen Medien wie mineralische und synthetische Schmieröle sowie -fette sein. Sie müssen mal Kälte, mal Hitze, mal Wasser, feuchter Luft, heißem Dampf, Ozon oder aggressiven Reinigungsmitteln widerstehen.
Dabei gilt die Faustformel: Die Geschwindigkeit chemischer Reaktionen verdoppelt sich bei einer Temperaturzunahme von zehn Grad Celsius (RGT-Regel). Das bedeutet im Umkehrschluss: Die Lebensdauer einer Gummidichtung reduziert sich bei steigenden Temperaturen enorm. Die Medienbeständigkeit von Gummiwerkstoffen ist also stark temperaturabhängig. Sie sinkt auch durch höheren Druck, höhere Geschwindigkeiten, höhere Reibung – denn alle diese Phänomene erhöhen die Temperatur.
In puncto Physik geht es bei Gummidichtungen vor allem darum, Quellung, Schrumpf und das Durchdringen des Dichtungswerkstoffs durch ein Gas, die sogenannte Permeation, zu vermeiden. Zudem reduziert geringe Reibung die Temperatur und damit den Verschleiß und den Energieverbrauch.
Gummi ist nicht gleich Gummi
Gummiwerkstoffe zeichnen sich im Allgemeinen durch große Elastizität, damit verbunden durch hohe Abdichtwirkung und Rückstellkräfte aus. In Kombination mit dem passenden Schmierstoff überzeugen sie durch gute Verschleiß- und Abriebfestigkeit. Einer der Nachteile des Werkstoffs Gummi: Mangels Härte eignet es sich nur begrenzt für Hochdruckanwendungen, beispielsweise in der Hydraulik.
Gummi ist nicht gleich Gummi. Einzelne Gummiwerkstoffe unterscheiden sich hinsichtlich Dichte, Härte, Zugfestigkeit, Verformungsverhalten, Temperatureinsatzbereich und vielen Kennwerten mehr. Sie eignen sich daher für unterschiedliche Einsatzbereiche.
Einige Beispiele: Standardwerkstoff von FST, zum Beispiel für klassische Simmerringe, ist NBR. HNBR hat eine höhere Temperatur- und Medienbeständigkeit. Silikon ist wenig abriebfest, ist daher besonders für statische Dichtungen erste Wahl. ACM kommt mit Kälte bis -40 Grad Celsius und Hitze bis 160 Grad Celsius gut klar, ist zudem ozon- und heißluftbeständig. FKM bewährt sich als vielseitiger Problemlöser. FFKM Simriz® heißt die Highend-Lösung von FST für die Prozessindustrie.
Auf dem Prüfstand
An mehreren FST-Standorten sind Prüffelder wesentliche Bausteine der Innovationskraft von FST. Wo liegen die Einsatzgrenzen neuer Werkstoffe? Halten sie den in der Elektromobilität vorherrschenden Highspeed-Drehzahlen stand? Wiederstehen sie neuartigen Schmierstoffen, den Folgen elektrischer Ladungsverschiebungen, Druck, Kälte, Spritzwasser, Schmutz, Schwingungen? Stresstests im Prüffeld bilden die Realität so nah wie möglich ab und liefern wichtige Erkenntnisse für die Praxistauglichkeit neuer Materiallösungen. Einsätze in Arktis und Wüste lassen sich hier genauso nachstellen wie Autofahrten durch Wasser und Schlamm. Das größte Simmerringe-Prüffeld ist in Weinheim. In Plymouth kann FST im Zeitraffer prüfen, wie sich Werkstoffe in Wasserstoff-Elektrolyseuren im jahrelangen Dauereinsatz bewähren.

Um jahrzehntelange Lebensdauern von Dichtungen abzusichern, wie sie beispielsweise in Offshore-Windkraftanlagen gefragt sind, reichen aber selbst 1.000-Stunden-Langzeittests auf dem Prüfstand nicht aus. Dafür sind digitale Simulationswerkzeuge unerlässlich. FST nutzt seit Jahren erprobte Modelle, beispielsweise für das Langzeit-Alterungsverhalten von Gummi in statischen Dichtungen.
Neue Aufgaben
Immer häufiger müssen Gummidichtungen Zusatzaufgaben übernehmen, die weit über das Dichten hinausgehen. Mal sollen sie elektrisch leitfähig sein, mal sollen sie Wärme oder elektromagnetische Strahlung abschirmen können. Oder sie sollen im sogenannten Condition Monitoring möglichst genau voraussagen, wann sie gewechselt werden müssen. FST entwickelt auch dafür Lösungen.